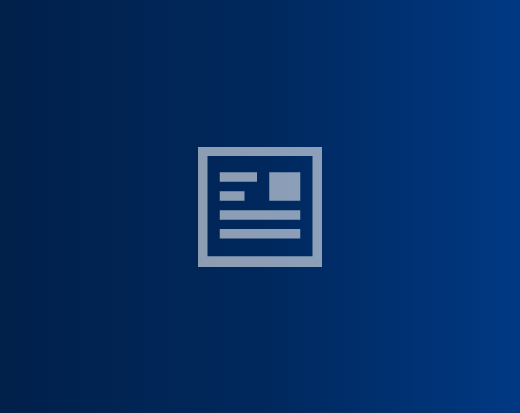Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat die Kreditwürdigkeit von Estland für langfristige Verbindlichkeiten mit der Note „AA-“ bestätigt. Auch…
PartnerForBaltics
Hashtag