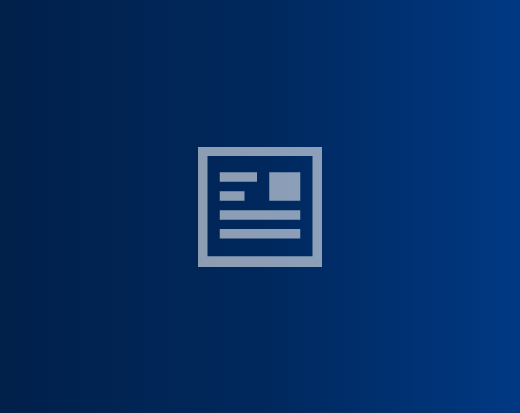In Zusammenarbeit mit Schweizer Kollegen behauptet das in Vilnius ansässige Unternehmen Northway Biotech, ein Heilmittel gegen das Coronavirus…
PartnerForBaltics
Hashtag